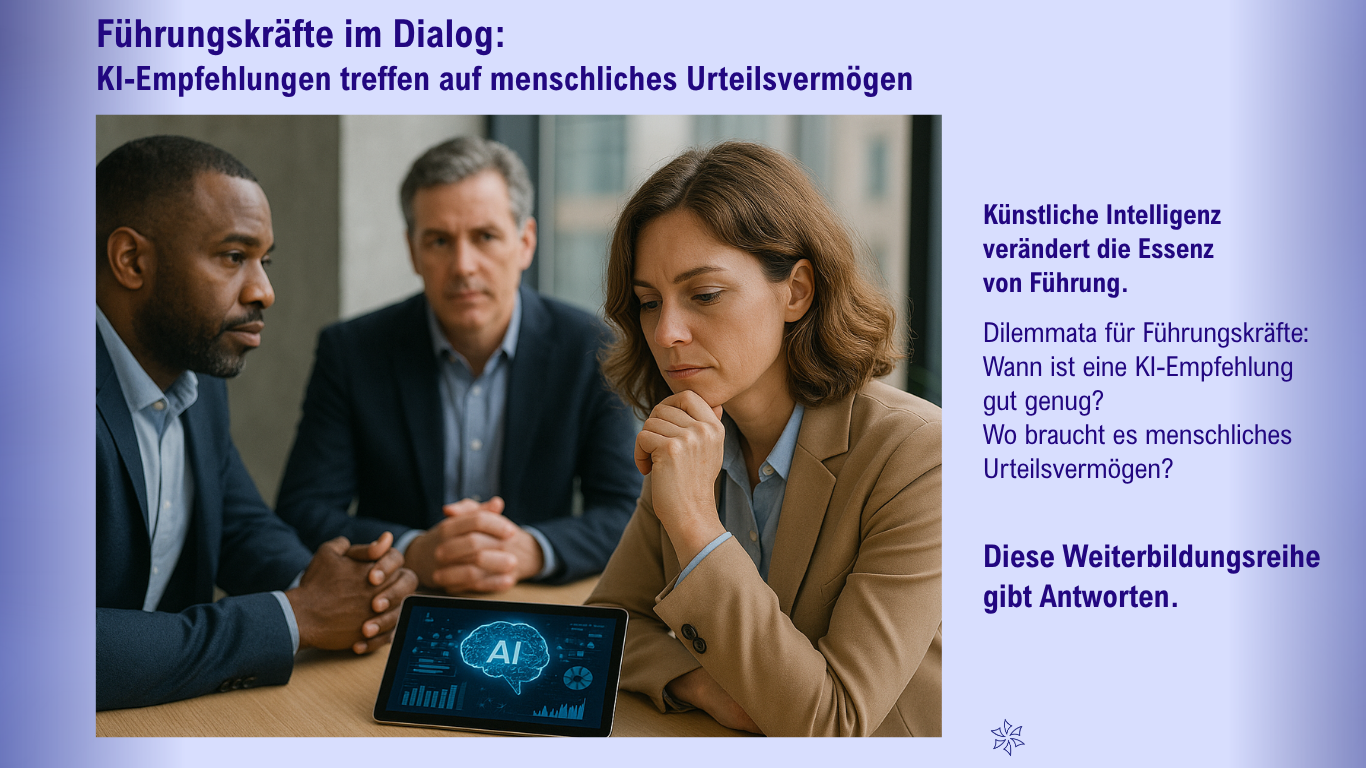Eigenlob als Führungskompetenz
28.6.2025

Eigenlob als Führungskompetenz: Warum Selbstanerkennung keine Überheblichkeit ist
Nach der Vorstandssitzung
Niemand sagt: "Gut gemacht." Du gehst zurück ins Büro. Allein. Die Entscheidung war schwierig, das Risiko hoch, der Widerstand spürbar. Aber du hast sie getroffen. Und jetzt? Stille.
Das ist die Realität vieler Führungskräfte: Je höher die Position, desto seltener die Anerkennung. Gleichzeitig hält sich hartnäckig die kulturelle Überzeugung: "Eigenlob stinkt." Die Folge? Ein gefährlicher blinder Fleck, der langfristig Energie, Resilienz und Entscheidungskraft kostet.
Das Feedback-Vakuum in der Führung
Die Forschung zeigt ein klares Muster: Je höher die Führungsebene, desto stiller wird es.
Über 70% der neuen CEOs berichten von Einsamkeitsgefühlen, und etwa 50% der CEOs und Senior Leader haben Einsamkeit und Isolation erlebt. Von diesen glauben 61%, dass dies negative Auswirkungen auf ihre Leistung hatte.
Die Gründe sind strukturell:
- Mitarbeitende halten sich mit ehrlichem Feedback zurück – aus Respekt, Angst oder strategischem Kalkül
- Peers sind oft Konkurrenten, nicht Vertraute
- Vorstände und Aufsichtsräte fokussieren Zahlen, nicht persönliche Entwicklung
Das Ergebnis ist ein Feedback-Vakuum, in dem niemand mehr sagt: "Das hast du gut gemacht." Die Konsequenzen reichen von Einsamkeit über Burnout bis hin zu Zynismus – alles Faktoren, die Führungsqualität massiv beeinträchtigen.
Die Psychologie des Stolzes: Nicht alle Formen von Eigenlob sind gleich
Hier wird es entscheidend: Stolz ist nicht gleich Stolz. Die Psychologinnen Jessica Tracy und Richard Robins unterscheiden in ihrer Forschung zwei grundlegend verschiedene Formen:
1. Authentischer Stolz
- Basiert auf konkreten Handlungen und Anstrengungen
- Beispiel: "Ich habe diese schwierige Verhandlung gut geführt, weil ich gut vorbereitet war."
- Korreliert mit Selbstkontrolle, Gewissenhaftigkeit und besserer Leistung
- Stärkt Selbstwirksamkeit und Resilienz
2. Überheblicher Stolz
- Basiert auf globaler Selbstüberhöhung
- Beispiel: "Ich bin der beste Verhandler hier."
- Korreliert mit Narzissmus, Impulsivität und schlechteren Beziehungen
- Führt zu antisozialem Verhalten
Die gute Nachricht: Authentischer Stolz wirkt wie ein psychologisches Immunsystem. Er schützt vor Erschöpfung und hält die intrinsische Motivation am Laufen – den Motor, der Führungskräfte langfristig leistungsfähig macht.
Was passiert, wenn der Motor ausfällt?
Wenn Führungskräfte keine Selbstanerkennung praktizieren, drohen konkrete Folgen:
→ Burnout – Der innere Antrieb erlischt, weil keine Energiequelle mehr nachfließt
→ Schlechte Entscheidungen – Chronischer Stress durch fehlende Anerkennung erhöht die Cortisol-Ausschüttung, was wiederum Urteilsvermögen und Kreativität mindert
→ Zynismus – Die emotionale Distanzierung vom eigenen Handeln als Schutzmechanismus
Eigenlob ist also keine Eitelkeit, sondern Selbstfürsorge – und damit eine Führungsaufgabe.
Wie Eigenlob in der Praxis funktioniert
Die entscheidende Frage: Wie gelingt gesunde Selbstanerkennung ohne in Überheblichkeit abzurutschen?
1. Konkret statt global
Nicht: "Ich bin großartig."
Sondern: "Ich habe diese Entscheidung gut getroffen, weil ich alle Perspektiven eingeholt und transparent kommuniziert habe."
2. Prozess statt Ergebnis loben
Nicht nur: "Das Projekt war erfolgreich."
Sondern: "Ich habe gut durchgehalten, auch als es Widerstand gab."
3. Wöchentliche Reflexion als Routine
Jeden Freitag: Notiere drei Dinge, die gut gelaufen sind. Das können große Entscheidungen sein oder kleine Momente, in denen du deine Werte gelebt hast.
4. Selbstwirksamkeit bewusst stärken
Frage dich: "Was hat mein Handeln heute bewirkt?" Das aktiviert den Glauben an die eigene Handlungsfähigkeit – laut Psychologe Albert Bandura einer der stärksten Prädiktoren für Führungserfolg.
Die Balance finden
Die Kunst liegt nicht darin, sich ständig selbst zu feiern. Die Kunst liegt darin, die eigene Leistung anzuerkennen, ohne sie über die anderer zu stellen.
Authentisches Eigenlob sagt nicht: "Ich bin besser als mein Team."
Es sagt: "Ich habe heute etwas Wertvolles beigetragen – für mich und für andere."
Diese Balance zu finden ist eine Übungssache. Aber sie ist lernbar. Und sie ist notwendig.
Fazit: Eigenlob ist Selbstführung
Führungskräfte, die sich nicht selbst anerkennen können, verlieren auf Dauer ihre Wirksamkeit. Sie werden abhängig von externer Bestätigung, die auf höheren Ebenen kaum noch kommt. Sie brennen aus, weil der innere Motor keinen Treibstoff mehr bekommt.
Eigenlob – richtig praktiziert – ist keine Schwäche. Es ist Selbstführung. Es ist die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, auch wenn niemand zuschaut. Und das ist eine Kernkompetenz, die jede Führungskraft braucht.
Möchtest du lernen, wie du Eigenlob als Führungsinstrument nutzt?
In meinen Trainings und Coachings arbeite ich mit Führungskräften daran, gesunde Selbstanerkennung zu entwickeln – ohne in Überheblichkeit abzurutschen. Wenn du das Gefühl hast, dass dir genau diese Balance fehlt, lass uns sprechen.
Kontaktiere mich für ein Erstgespräch: [Kontaktformular/E-Mail]
Quellen
- Harvard Business Publishing: Leadership loneliness statistics
- RHR International / Vistage: CEO loneliness and performance impact study
- Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007): The Psychological Structure of Pride: A Tale of Two Facets. Journal of Personality and Social Psychology
- Bandura, A. (1997): Self-Efficacy: The Exercise of Control
- Sapolsky, R. M. (2004): Why Zebras Don't Get Ulcers (chronischer Stress und kognitive Beeinträchtigung)
Lesen Sie hier mehr über unsere Kompetenzen